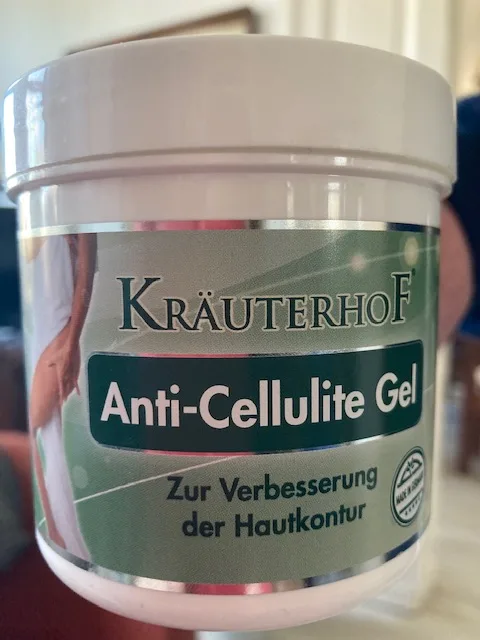Wie ging es weiter? Mit der „Integration“ von Familie Gläser in die Bundesrepublik Deutschland bzw. in das alliierte Westberlin? Das war so:
Klaus Renft fuhr uns nach Marienfelde, in die damalige Aufnahmestelle für Übersiedler in Berlin-Tempelhof. Dort waren fast nur Ostdeutsche und sehr sehr viele Polen. Polen, die ihr „Deutsch-Sein“ nachweisen konnten. Als wir ankamen, Peter und ich, zwei kleine Kinder, Ben und Moritz, und ein jugendlicher Robert, hielt man uns vermutlich an der Pforte für Polen. Wir müssen etwas bunter gewirkt haben. Die Wächter am Eingang des „Auffanglagers“ sprachen uns in gebrochenem Deutsch an. „Sie verstehen deutsche Sprache?“ – „Ja, wir verstehen. – „Gut. Haben Ausweis?“ – „Nicht mehr. Wir sind aus Leipzig!“ – „Ach so, wir dachten aus Polen!“ – Ok, das verstand ich erst einmal nicht. Doch sollte ich es später verstehen, dann, als wir „eingegliedert“ wurden. In ein Studentenheimartiges Zimmer – zu fünft mit Doppelstockbetten – um uns herum wurde polnisch gesprochen. „Miiichai!“ – ertönte es aus dem Nebenzimmer. Robert – schon damals unser Parodist – hatte das ganz schnell drauf: „Miiichai“ – mit einem ch wie in ach. Er rief es ständig inbrünstig überall herum, so dass ich ihn schon mäßigen musste. Michail wurde oft gerufen. Und überhaupt – diese Polen. Überall waren sie. Überall waren sie die Ersten. Und erstmalig bekam ich ein Gefühl dafür, eine Deutsche zu sein.
Wir hatten es ja in der DDR nicht so mit dem Deutschsein, auch wenn das heute viele denken. Das Wort Deutschland wurde gemieden wie die Pest. Wir hatten es zwar im DDR-Namen und auch im SED-Namen, aber ansonsten kam es nicht vor. Nur als Sigmund Jähn ins Weltall geschossen wurde, las ich erstmalig wieder in den DDR-Zeitungen: „Der erste Deutsche im All“. Aha, sind wir also doch Deutsche. Wir lachten damals darüber. Ansonsten machten wir uns darüber nicht soo viel Gedanken. Wir waren DDR-Bürger, wenn auch nicht gern. Plötzlich sollten wir also anerkannt „Deutsche“ werden. Dafür mussten wir diverse Stationen durchlaufen – in diesem „Lager“. Ich zähle sie auf, den „Laufzettel“ hab ich heute noch:
Ärztlicher Dienst
Sichtungsstelle
Weisungsstelle
Bundesaufnahmestelle Berlin (Annahme des Antrages, Vorprüfung, Ausgabe des Aufnahmescheins)
Landeseinwohneramt Berlin – Meldestelle
Bundesanstalt für Arbeit
Allgemeine Ortskrankenkasse Berlin
Zentrale Beratungsstelle für Aussiedler und Zuwanderer
Sonderbetreuung und Beratung für ehemalische politische Häftlinge
BVG-Freifahrtausweise
Taschengeld
Bekleidungsbeihilfe
Friedlandhilfe
Alliierte: Franzosen. Briten. Amerikaner.
Bundesverfassungsschutz
Diverse Beratungsangebote der Kirchen, Arbeiterwohlfahrt, Landesausgleichsamt Berlin etc.
Ohne einen Stempel von all diesen Stationen konnte man die Aufnahmestelle nicht verlassen. Es war ein „Run“ auf diese Institutionen, bei dem die Polen irgendwie schneller waren. Einer der Gründe für beginnende Feindseligkeiten der Ostdeutschen gegenüber den Polendeutschen, die allerdings kein Deutsch sprachen und das einfach ignorierten. Die meisten Beamten machten gegen Mittag Schluss. Dann musste man auf den nächsten Tag warten und die Nachmittage irgendwie rumbringen. Ich entschloss mich, jeden Tag um halb vier aufzustehen, nahm mir ein Buch und stellte mich gegen 4.00 Uhr an. Ich war nicht allein, aber es klappte, so dass wir nach ca. zehn Tagen „raus“ waren.
Zwei lustige Erlebnisse: Bei den Amerikanern hatten wir es mit einer älteren Dame mit polnischem Namen und breiten amerikanischem Akzent zu tun. Sie fragte meine Musikermann Peter, neben seltsamen Fragen über die Truppenstärken an der Grenze während seines damals bereits zwanzig Jahre zurückliegenden „Dienstes“ bei der Nationalen Volksarmee der DDR, folgendes: „Und Sie sind also Musiker! Spielen Sie Reggae?“ Peter verstand sie nicht. Und guckte dumm. Sie fragte etwas lauter: „Und, spielen Sie Reggae??!! (Ich flüsterte ihm zu: Ob Du Reggae spielst, sag einfach ja! Du hast doch da so einen „Katzenjammerreggae“!) – Peter aber sagte: „Nein, ich spiele keinen Reggae.“ – Die strenge Amerikanerin antwortete zufrieden: „Very good, Reggae kann ich nämlich nicht leiden!“ Sprach‘s und entließ uns wieder nach draußen.
Die zweite amüsante Begebenheit trug sich bei der Übergabe unseres sogenannten Aufnahmescheines der Bundesaufnahmestelle Berlin zu. Die Beamtin erklärte uns, dass wir diesen Schein nicht verlieren dürfen. Es sei wie eine neue Geburtsurkunde – für die ganze Familie. – Kleiner Einschub: Ich kann mich nicht erinnern, den jemals wieder gebraucht zu haben. – Aufgezählt im ominösen Aufnahmeschein waren also: Gläser, Peter, geboren in Leipzig. Gläser, Elisabeth, geboren in Leipzig, Leipzig, Robert, geboren in Leipzig, Gläser, Benjamin, geboren in Leipzig und Gläser, Moritz, geboren in Leipzig. Sie schaute noch einmal irritiert auf die Urkunde und fragte plötzlich: „Haben Sie ein Kind, das mit Nachnamen Leipzig heißt? Da steht „Leipzig, Robert“, geboren in Leipzig?“ – „Das haben Sie geschrieben, sagte ich, „war wohl bisschen viel Leipzig auf einmal…“. Wir lachten und sie änderte die Urkunde. So wurde aus „Robert Leipzig“ wieder ein „Robert Gläser“. Und wir konnten das Aufnahmelager verlassen. Ausgestattet mit etwas Geld und einer Art Zuweisung für eine Pension in Berlin-Charlottenburg. (Das ist aber eine neue Geschichte).
P.S. Ich hab noch etwas vergessen. Robert hatte, ehe wir nach Westberlin ausreisten, nagelneue Schuhe im „Exquisit“ gekauft, also in einem der DDR-Läden, in denen alles fünfmal teurer, als in normalen Läden war. Diese Schuhe – sein ganzer Stolz damals – hatte er in dem engen Doppelstockbett-Zimmer in Marienfelde in eine Plastiktüte gesteckt und an die Tür gestellt. Die Tüte hab ich aus Versehen mit den anderen Abfalltüten in den Müll gegeben. Robert rannte dem davonfahrenden Stadtreinigungsauto noch rufend und gestikulierend hinterher. Vergebens. Und er war versucht zu glauben, so wunderschöne Schuhe niemals mehr im weiteren Leben zu besitzen. – Den versehentlichen Wegwurf hat er mir mindestens ein Jahr nicht verziehen.