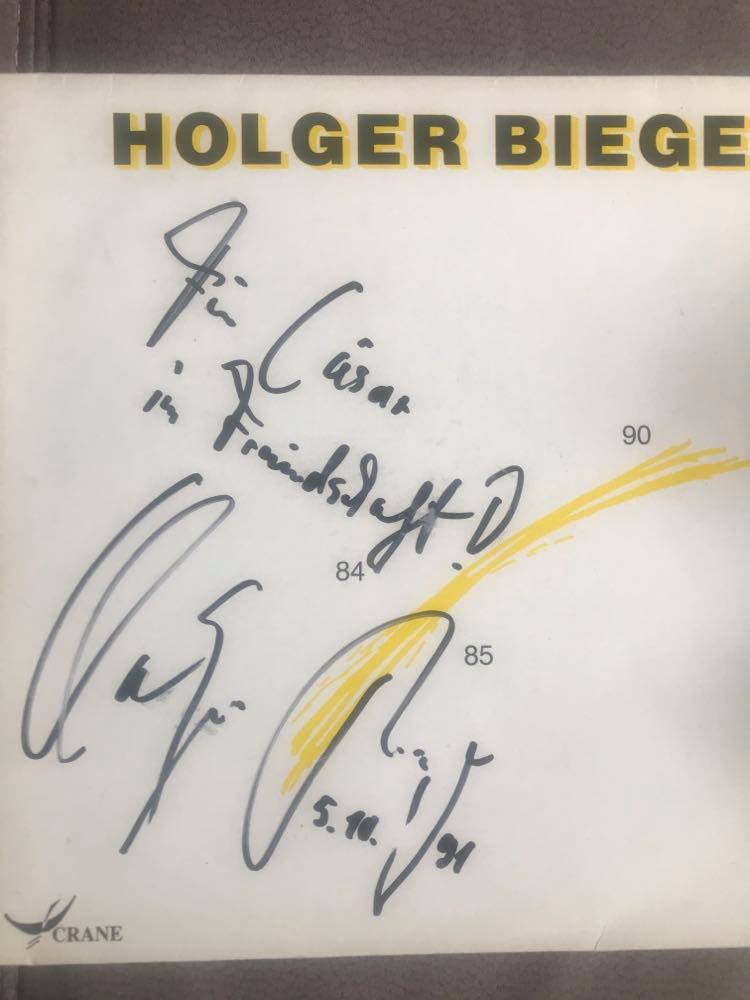Mein neues Jugendstilhaus in Magdeburg. Es hat einen Glasfaserkabelanschluss der Deutschen Telekom. Mit vorinstalliertem Modem in jeder Wohnung. Ich sah dieses Modem. Es liegt groß und gut sichtbar neben der Eingangstür rechts. Dazu das legendäre Glasfaserkabel in eigens dazu eingebauten „Hüllen“, die wie Überputzleitungen der neuen Zeit aussehen – aber viereckig. Aber: Nach Bestellung der „vollen Packung“, Festnetz (müssen Sie leider nehmen), DSL und ein Riesenpaket Gigabyte wird mir nach zwei Wochen mitgeteilt: Leider können wir Ihnen kein Internet bereitstellen. „Unser Zeitfenster“ ist der 3. Oktober! (Sic! ist das der Nationalfeiertag, oder wie heißt das heute? Vielleicht nur noch „Der Feiertag“?). Nun ja. Ich habe kein Internet. Fuhr flugs noch einmal nach Magdeburg in den dortigen Telekom-Shop. Es empfing mich ein – ich sage das jetzt mal so, obwohl ich das Wort nicht mag – Vollhonk. Aber mit Schuhen in den Farben des Unternehmens. Pinke Turnschuhe. Nein, wir können Ihnen kein DSL bereitstellen. – Wann können Sie denn? – Das Zeitfenster ist Oktober. Aber Genaues weiß man nicht! – Dann vielleicht ein Festnetzanschluss. – Nein, auch ein Festnetzanschluss ist nicht möglich. – Also – nichts. – Ja, so ist es. – Ist ja wie in der DDR! – Er sagte nicht: Sie sind in der DDR! Dafür fehlte ihm Bildung und Humor. Ich weiß schon, warum ich die Deutsche Telekom einfach unterirdisch finde. Also kaufte ich mir, um arbeiten zu können, nun einen Giga Cube bei Vodafone. Wer das noch nicht kennt: Man kauft ein Gerät, das aussieht, wie aus der Zukunft. Einen Cube. Weiß und geheimnisvoll. Und steckt dieses Ding per Strippe in die Steckdose. Dann haste Internet. Und zwar 200 GB im Monat. Und zwar überall, wo eine Steckdose ist. Ich könnte fast wie eine Grüne jubeln. Alles Gute kommt aus der Steckdose. Aber da ist eine Chip-Karte drin. Es funktioniert also wie ein Handy. Die erste Schreckensrechnung zum Wundergerät traf heute auf meinem Konto ein. – Das nur eines der kleinen Nebenprobleme 🙂 Aber immerhin ermöglichen die mir Internet, damit ich arbeiten kann. Magdeburg ist ja kein Dorf im Hinterland, sondern eine Landeshauptstadt. Die Wohnung hat einen Glasfaseranschluss, aber ich kann dort und damit nicht arbeiten. Nur mit dem Vodafon-Cube. Danke Telekom! Für die Glasfaserbesatzung und das bewährte Nicht-Gelingen von großartigen Vorhaben.
Diesen Text pinnte ich der Telekom auf die Facebook-Seite. Eine Freundin riet mir, auch etwas bei der Facebook-Seite „Telekom hilft“ zu hinterlassen. Ich hinterließ den gleichen Text. Beide beantwortet von Anja von der Telekom, die „helfen“ wollte und mit mir telefonierte. „Elisabeth, wir klären das. Ich bin Anja, ich bin für Dich da!“ Super. Super-Anja. Das Ergebnis unseres Telefonats war, dass ich ca. 48 Stunden später eine Mail erhielt, die mir die Bestellung eines höheren Tarifes für mein Handy, über das wir gar nicht gesprochen hatten, bestätigte. Ich wühlte mich durchs Telekom-Telefon-Menue, um zu fragen, was das für eine Bestellung sei, die ich nicht ausgelöst habe, keiner wusste es. – Ich stornierte die Bestellung und schrieb Anja, dass das ja nun irgendwie „nichts“ war, oder eben fatal, was bei ihrer Hilfe herausgekommen wäre. Eine „Geisterbestellung“. Anja meldete sich nie mehr bei mir, dafür Markus von „Telekom hilft“. Wir telefonierten lange und ausgiebig am Abend, denn Markus ist immer abends da, wie er mir sagte, und er wird fortan mein „Begleiter“ sein, wenn ich Telekom-Probleme habe. Zunächst kündigte er mir an, er versprach es geradezu verschwörerisch, dass ich am 22. August in meinem Glasfaserkabelhaus nun doch einen Internetanschluss bekomme. Wie von allein wird er an diesem Tag aufgeschaltet, kein Techniker wird erscheinen, es passiert, versprach mir Markus. Spätestens bis 21.00 Uhr. Nun harre ich der Dinge und hoffe, dass die Markus-Glaskugel das Richtige prophezeite. Ich halte hier auf dem Laufenden 🙂